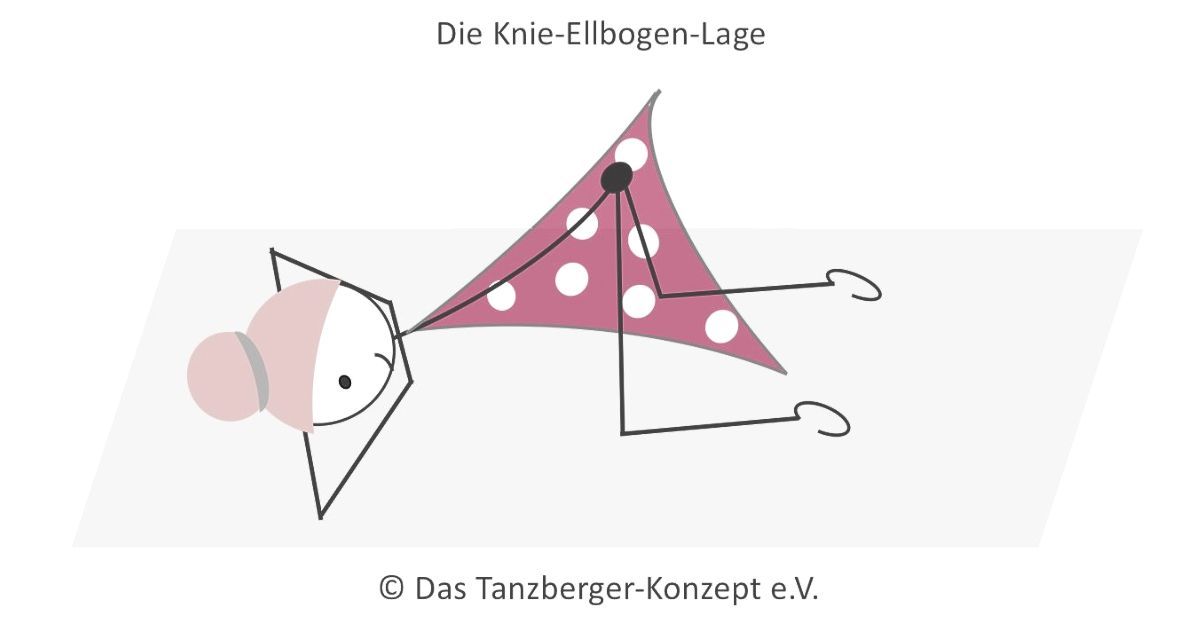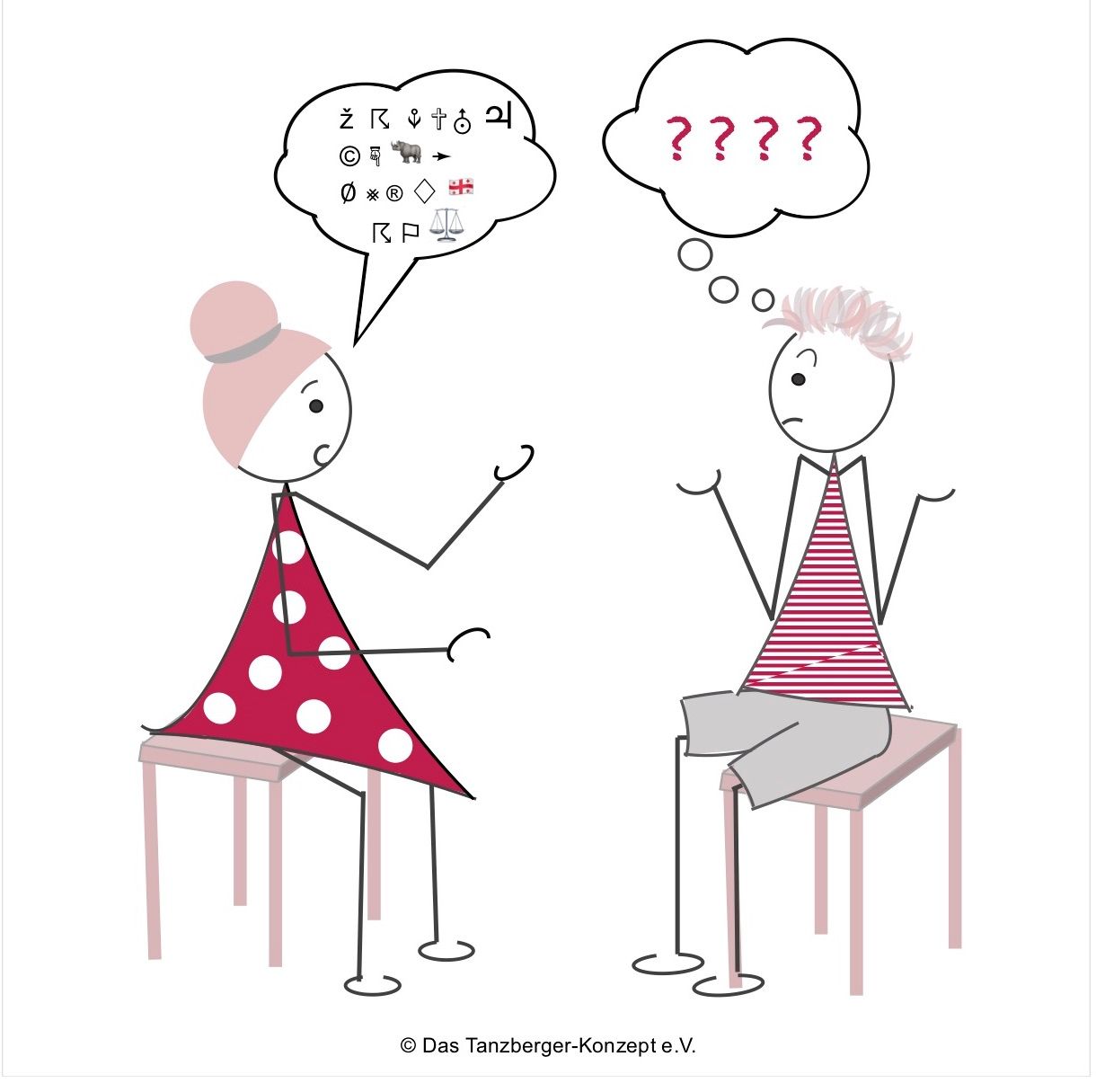Das Tanzberger-Konzept
DER VEREIN
Fragen RAT Tipp Geburt Übung Wissenscheck Film Alter CLIP
Harnblase
Blasenentzündung Erklärung
Kaiserschnitt
Kaiserschnittnarbe
Gurtfunktion ViDEO Prävention Lagerung Text Entleerungsstörung RückbilduNG Bauchmuskulatur rESTHARN Autotransfusion Lachen Bewegungsanalyse TONUSREGULATION download Übungsanleitung GEBURT BÜCKEN ADL Aufschubstrategie Schnüren durchblutung Soforthilfen Atmung leitlinieN Information Textbeitrag Hämorrhoiiden WISSENSFRAGEN ÖKONOMISCH TRAMPOLINFUNKTION Übungen KONTINENZPHYSIOTHERAPIE Schnürfunktion atemtherapie Heben Sectio Sectionarbe NARBENBEHANDLUNG
Anleitung
Bücken
Demomaterial
Tragen
Operation Kontinenz
Inkontinenz
Sphinktertraining
Sphinkter Verein
Kontinenzentwicklung
Kontinenzpflege
Ausscheidungsautonomie
SEXUALITÄT
Workshop
Befunde
BECKENBODENTHERAPIEBALL
FASZIEN
IMAGINATION.
EXPLOSIVLAUTE INSTRIKTION

DEFINITION - URSACHEN - SYMPTOME - HILFEN
FIRST OF ALL: WAS KENNZEICHNET DIE GESUNDE BLASENFUNKTION?
SPEICHERPHASE
DIE MUSKULÄR-ELASTISCHE HARNBLASE FÜLLT SICH DRUCKLOS ÜBER MEHRERE STUNDEN BIS ZUM ERREICHEN IHRER FUNKTIONELLEN KAPAZITÄT.
- Zur Sicherung der Kontinenz in der Harnsammel- und Speicherphase bauen v.a. die urethralen Sphinkter des Diaphragma pelvis adaptativ Tonus auf, und die Blasenwand entfaltet sich sukzessive mit steigendem Füllvolumen. Der Musculus detrusor vesicae passt sich ohne Tonuserhöhung bis zum imperativem Drangsignal (= Erreichen der funktionellen Blasenkapazität) dem steigenden Volumen an.
MIKTIONSPHASE
Die funktionelle Blasenkapazität ist im besten Fall erreicht, und die Miktion soll - nach willkürlichem Entschluss - am definierten Entleerungsort stattfinden.
- Die urethralen Sphinkter und das Diaphragma pelvis relaxieren, während der Detrusor vesicae - der Austreiber der Blase - tonisiert; die Entleerung beginnt.
- Die Miktionsphase endet mit der vollständig entleerten Blase, um dann wieder in die Speicherphase überzugehen. Ein neuerlicher Zyklus von Harn sammeln, speichern und entleeren beginnt.
WAS VERSTEHT MAN UNTER RESTHARNBILDUNG UND
WANN SPRICHT MAN VON PATHOLOGISCHEM RESTHARN?
RESTHARNBILDUNG
ist Symptom einer Harnblasenentleerungsstörung:
Die Blase entleert nur unvollständig, so dass nach Beendigung der willkürlichen Entleerung Harn in der Blase verbleibt = Restharn.
PATHOLOGISCH:
signifikant krankhaft und damit behandlungs-bedürftig wird beim Erwachsenen nach beendeter Miktion ein Restharnvolumen von > 100 ml definiert (Kinder: > 10% der funktionellen Harnblasen-kapazität;
Riedmiller et. al., EAU guidelines on paediatric urology, 2001).
Was sind
Ursachen
für eine
reversible
Restharnbildung?
Z. n. Botoxinjektion in die Blasenwand
- bei Patient*innen mit starker Dransymptomatik.
- die Restharnbildung kann Wochen bis Monate andauern
- sie ist aber passager
Z.n. Peridualanästhesie
- zur Geburtserleichterung
- postpartal sollte eine Miktion spätestens 4-6 Stunden nach der Geburt erfolgen!!!
Was KÖNNEN UrsacheN eineR CHRONISCHEN Restharnbildung SEIN?
Die Ursachen sind divers. Daher sollen hier einige wichtige Beispiele genannt werden:
Männliche Patienten:
Subvesikale Traumata
und/oder Abflussbehinderung
durch Obstruktion der Harnröhre,
z.B. durch
- bPh oder Prostata-CA
- postoperative Anastomosestrikuren
- Vernarbungen der Harnröhre
- Alterungs-prozess
Weibliche PatientINNen:
Deszensus urogenitale (Quetschhahnphänomen = abknicken der Urethra)
Tumore im Beckenraum
Z.n. Deszensus und/oder Inkontinenz-op (Mechanische Störung durch subvesikale Abflussbehinderung)
Z. n. Urethritis (Narben der urethralen Schleimhaut)
- Alterungs-prozess
Neurogene Blasenfunktionsstörung
Zentraler Genese, z. B.
- nach Apoplex
- Morbus Parkinson
- Multipler Sklerose
Spinaler Genese, z. B.
- bei Diskusprotusion- oder Prolaps
- Traumata der WS
- Fehlbildungen (Bsp.: Spina bifida)
Peripherer Genese, z. B.
- nach operativen Interventionen im Beckenraum
Systemischer Genese, z.B.
- bei Diabetes mellitus
IATROGENE Blasen-ENTLEERUNGSSTÖRUNG
TRANSIENT / PASSAGER, Z.B.
- NACH INTRAVESIKALEN BOTOXINJEKTIONEN ZUR THERAPIE VON URGENCY ODER URGEINKONTINENZ
- NACH PDA
- nach RADIOLOGISCHEn THERAPIEN
Pelvine Tumore
z. B.
Myome, Fibrome oder Karzinome
Operative Interventionen,
z. B. Neoblase
INFRAVESIKALE OBSTRUKTION
Z. B.
SUBVESIKALE TUMORE
BENIGNE PROSTATAHYPERPLASIE
PROSTATA-CA
DESZENSUS ODER PROLAPS UROGENITALE
Z. N. INKONTINENZ-OP (Z.B. TVT BAND, BULKING AGENS)
SPHINKTERHYPERTONUS
UND/ODER HYPERTROPHIE URETHRALE
SPHINKTERSKLEROSE (URSÄCHLICH SIND MEIST INFEKTIONEN IM UROGENITALTRAKT).
FUNKTIONELLE ENTLEERUNGSSTÖRUNG der Blase, Z. B.
PSYCHOGENER GENESE
DETRUSOR-SPHINKTER-DYSFUNKTION
MEDIKAMENTEN-NEBENWIRKUNGEN, Z.B.
BEI SUBSTITUTION VON
- ANTIHISTAMINIKA
- ANTIDEPRESSIVA
- ANTICHOLINERGIKA
Welche Symptome kann eine chronische Restharnbildung verursachen?
Welche Risiken birgt eine chronische Restharnbildung?
Eine chronische Restharnbildung ist ein schleichend stattfindender Prozess, der zunächst symptomlos abläuft und nicht bewusst wahrgenommen wird. Später auftretende Symptome und Risiken infolge einer Chronifizierung:
Symptome, wie z.B.
Urgency mit Pollakisurie und Nykturie
Restharngefühl mit imperativem Entleerungsdrang bei adäquaten Entleerungsmengen in kurzen Intervallen
Startverzögerung
Abgeschwächter Harnstrahl bei subvesikaler Obstruktion oder Detrusorinsuffizienz
Einsatz der willkürlichen Bauchpresse, zunächst zum Start, später auch im Verlauf bis hin zum Abschluss der Miktion
Verlängerte Entleerungszeit
Sich im Verlauf der Speicherphase aufbauende Schmerzen im Unterbauchbereich (Blasen-Dehnungsschmerz), die einige Zeit nach erfolgter Entleerung abklingen
Risiken, wie z.b.
Rezidivierende Harnwegsinfekte
- des unteren Harntraktes (Blase und Harnröhre) und ggf. auch
- des oberen Harntraktes (Harnleiter, Nieren)
Harnsteinbildung
Entstehen von Blasendivertikeln
Harnstau (obstruktive Uropathie) mit Niereninsuffizienz
Überlaufinkontinenz mit Harnträufeln ohne spürbaren Harndrang.
Wie wird die Restharn-menge gemessen?
Die einfachste und schonendste Methode zur Bestimmung der Restharnmenge ist die Restharnsonographie nach erfolgter spontaner Blasenentleerung
Gibt es für Patienten Hilfen zur Selbsthilfe?
Der Faktor Zeit ist (häufig für Senioren) entscheidend, d.h.
- sich für den Abschluss der Miktion Zeit lassen!
- nach anscheinender Beendigung der Entleerung noch etwas länger mit entspanntem Gesicht bis zur vollständigen Entleerung sitzen bleiben
-> siehe auch Beitrags-Tipp am Ende diesen Textes
Ist die Ursache der Restharnbildung der Deszensus der Organe des kleinen Beckens und/oder der Beckenboden- Sphinkter-Einheit?
Hier kann die Verwendung eines individuell angepassten Pessars durch den/die (Uro-)Gynäkolog*in hilfreich sein:
> Die mechanische Reposition mithilfe des Pessars hebt den Blasenboden an und entlastet das Diaphragma pelvis.
> Kombiniert werden sollte dies mit den therapeutischen Angeboten aus dem Tanzberger-Konzept®.
Und wenn das allein nicht hilft?
Liegt der Restharnbildung eine mechanische Abflussbehinderung zugrunde
- z. B. durch eine Prostatahyperplasie oder eine Anastomosestriktur/Urethrastriktur, so erfolgt i.R. eine operative Intervention.
- z.B. durch einen urogenitalen Deszensus oder Prolaps, so kann dieser je nach Ausmaß und Symptomatik zunächst konservativ mithilfe einer Pessarversorgung und/oder eine funktionsspezifischen und systemischen Physiotherapie therapiert oder auch operativ korrigiert werden.
Hinweis:
Präoperative physiotherapeutische Unterweisung ist unbedingt wünschenswert!
Liegt der Restharnbildung eine neurogene Blasenfunktionsstörung zugrunde
- kann ggf. eine Medikation in Tablettenform hilfreich sein
Die Ursache der Restharnbildung kann nicht behoben werden?
Dann erlernt der Patient mithilfe der professionellen Einweisung durch einen Urotherapeuten, den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK)
- Männer können den Katheter unter direkter Sicht bzw. Frauen zunächst unter Sicht mithilfe eines Spiegels, später auch direkt in die Urethra einführen und bis zur Blase schieben.
- Nach vollständiger Entleerung mittels Katheter wird dieser gezogen und entsorgt.
Dieser Vorgang ist i.R. schmerzfrei und kann gut in den Lebensalltag integriert werden, ohne den Patienten in seiner Flexibilität einzuschränken.
Alternativ kann man, ggf. vorübergehend, einen suprapubischen Dauerkatheter zur Harndrainage legen. Dieser ist für den Patienten komfortabler als der ISK und minimiert die Gefahr von Harnwegsinfekten.

TIPP:
Weiteres zu
HILFE ZUR SELBSTHILFE findest du im Beitrag: "NACHSITZEN" AUF DER TOILETTE