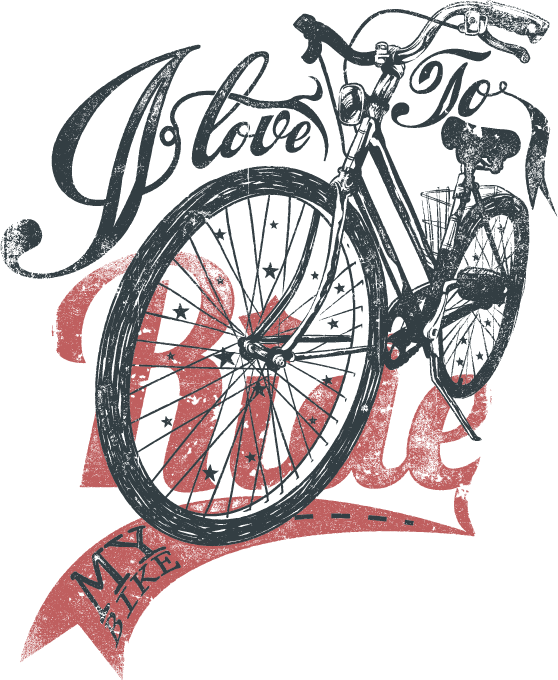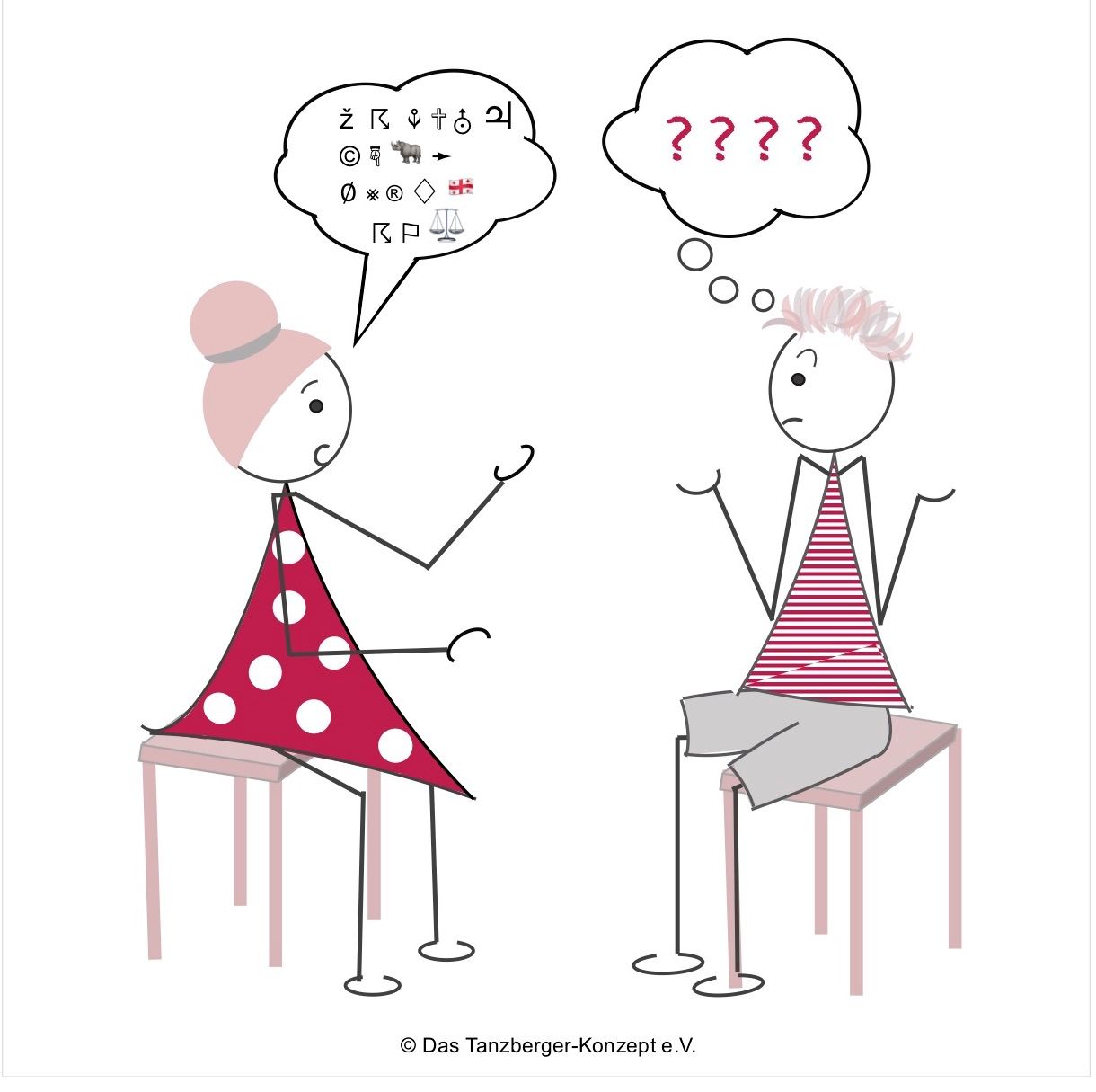Das Tanzberger-Konzept
DER VEREIN
Fragen RAT Tipp Geburt Übung Wissenscheck Film Alter CLIP
Harnblase
Blasenentzündung Erklärung
Kaiserschnitt
Kaiserschnittnarbe
Gurtfunktion ViDEO Prävention Lagerung Text Entleerungsstörung RückbilduNG Bauchmuskulatur rESTHARN Autotransfusion Lachen Bewegungsanalyse TONUSREGULATION download Übungsanleitung GEBURT BÜCKEN ADL Aufschubstrategie Schnüren durchblutung Soforthilfen Atmung leitlinieN Information Textbeitrag Hämorrhoiiden WISSENSFRAGEN ÖKONOMISCH TRAMPOLINFUNKTION Übungen KONTINENZPHYSIOTHERAPIE Schnürfunktion atemtherapie Heben Sectio Sectionarbe NARBENBEHANDLUNG
Anleitung
Bücken
Demomaterial
Tragen
Operation Kontinenz
Inkontinenz
Sphinktertraining
Sphinkter Verein
Kontinenzentwicklung
Kontinenzpflege
Ausscheidungsautonomie
SEXUALITÄT
Workshop
Befunde
BECKENBODENTHERAPIEBALL
FASZIEN
IMAGINATION.
EXPLOSIVLAUTE INSTRIKTION
AUSSCHEIDUNGSAUTONOMIE
Die Entwicklung der Blasenkontrolle

Der etwas sperrige Terminus „Ausscheidungsautonomie erlangen“ ersetzt seit Kurzem in Fachkreisen den bisher verwendeten Begriff der „Sauberkeitserziehung“.
Begründung für die Umbenennung: Die „Erziehung zur Sauberkeit“ vermittelt, dass die Kompetenz bei den Eltern, Großeltern, Erzieher:innen liegt, und somit der Erfolg oder Misserfolg v.a. von der Erziehungsleistung abhängt. Das Kind wird also zum „Sauberwerden“ erzogen.
Der Erwerb der Kontrolle über Blase und Darm folgt jedoch intrinsischen kindlichen Reifungsprozessen in individuellen Schritten. Die Rolle der Erziehenden ist, die Entwicklung - unter Berücksichtigung der physischen und emotionalen Reifung des Kindes - verständnisvoll zu begleiten und zu unterstützen.
Ausscheidungsautonomie was ist damit gemeint?
Es bedeutet, dass alle Vorgänge, die mit der selbstbestimmten Entleerung von Blase und Darm einhergehen, auf eigene Initiative hin und selbständig ausgeführt werden können. Dazu gehören neben dem rechtzeitigen Wahrnehmen vorausgehender Körpersignale auch deren richtige Interpretation, das Planen und Umsetzen des Toilettengangs, sowie das Erledigen der erforderlichen, hygienischen Begleitmaßnahmen.
Voraussetzung zum Erwerb dieser Fähigkeiten sind das Vorhandensein intakter anatomischer Strukturen und ein ausgereiftes Nervensystem (parasympathisch, sympathisch, somatisch).
Wie wird ein Kind ausscheidungsautonom?
Antwort: Infolge eines vier bis fünf Jahre andauernden Reifungsprozesses, welcher in mehreren, ineinander übergehenden Phasen abläuft. Diese notwendigen Zeiträume können weder in ihrer Reihenfolge, noch in ihrem zeitlichen Ablauf von außen beeinflusst werden:
- Die automatische, unwillkürliche Blasen- und Darmentleerung des Neugeborenen wird subkortikal gesteuert: die Dehnung des Speicherorgans führt zum Kontraktionsreflex
- Die physiologisch unreife Blase / das unreife Anorectum mit Hyperaktivität und Dranginkontinenz aufgrund fehlender kortikaler Hemmung.
- Die ausgereifte Funktion: Hyperaktivität wird kortikal gehemmt.
Der Zeitraum der einzelnen Phasen ist individuell bestimmt, da diese - wie der gesamte Prozess- hauptsächlich von der Ausreifung des ZNS abhängen.
Vorgezogene Maßnahmen, wie Töpfchen-Training oder Auf-die-Toilette-schicken beschleunigen die Entwicklung nicht. Der so erzielte Erfolg basiert auf Konditionierung und genauer Überwachung des kindlichen Verhaltens, jedoch nicht auf der selbständigen Kontrolle.
Siehe Infobox
Wann wird ein Kind ausscheidungsautonom?
„Viele internationale Studien zeigen, dass Kinder im Durchschnitt mit 28 Monaten am Tag trocken werden und mit durchschnittlich 33 Monaten stabil trockene Nächte haben. (...) Die Sensation dabei ist: diese Zahlen sind völlig unabhängig davon, ob Eltern eine Sauberkeitserziehung durchgeführt haben oder nicht!“ (Dr. rer. nat. habil. G. Haug-Schnabel, 2014, kizz.)
Die Kontrolle der Darmausscheidung gelingt 90% aller Kinder bereits mit drei Jahren. Im Alter von vier Jahren sind es bereits 97%, zugleich aber erst 75%, die über eine sichere Kontrolle der Blasenentleerung verfügen.
INFOBOX
Der Schweizer Kinderarzt Prof. Dr. Renzo H. Largo erstellte die bisher einzige Langzeitstudie zur Auswirkung unterschiedlicher Erziehungsstile auf die kindliche Entwicklung. Darunter wurde auch der Erwerb der Blasen- und Darmkontrolle dokumentiert.
Die Studie lief in zwei Teilen ab. Sie wurden in den Jahren 1954 bis 1956 (erste Züricher Studie) und von 1974 bis 1982 (zweite Züricher Studie) mit je ca. 320 Kindern durchgeführt. So konnten der Einfluss des Erziehungsverhaltens auf den Erwerb der Blasen- und Darmkontrolle genau untersucht werden.
Hier sind einige Ergebnisse aus den beiden Longitudinalstudie aufgeführt. Nachzulesen sind die dazu erschienen Publikationen unter: https://www.remo-largo.ch/uebersichts-arbeiten.html
Erste Züricher Studie
1954 - 1956
Beginn der Sauberkeitserziehung
- innerhalb der ersten drei Monate bei 13% der Kinder
- innerhalb der ersten sechs Monaten bei32 % der Kinder
- innerhalb des ersten Jahres: 96 %
Zweite Züricher Studie
1974 - 1982
Beginn der Sauberkeitserziehung
- früheste Angaben mit dem neunten Monat
- innerhalb des ersten Jahres bei 20% der Mädchen, bei 16% der Jungs
- innerhalb von 33 Monaten bei 90% der Kinder
Zusammenfassung
In der zweiten Zürcher Studie begann die Erziehung zur Blasen- und Darmkontrolle im Vergleich zur ersten Studie später
- bei den Mädchen um 12 Monate später
- bei den Jungs um 14 Monate später
Erste Züricher Studie
1954 - 1956
Töpfchentraining: > 5x /Tag
- bei 44 % der Eineinhalbjährigen
- bei 24 % der Zweijährigen
Zweite Züricher Studie
1974 - 1982
Töpfchentraining: > 5x /Tag
- bei weniger als 5 % der Kinder wurde diese Intensität durchgeführt
Zusammenfassung
Die Kinder der ersten Züricher Studie wurde im Vergleich zur zweiten Studie durchschnittlich 1300x häufiger auf das Töpfchen- oder die Toilette gesetzt.
Erste Züricher Studie
1954 - 1956
Blasenkontrolle tagsüber erfolgreich
mit 24 Monaten bei
- ca. 15% der Jungs und
- ca. 25% der Mädchen
mit 36 Monaten bei
- ca. 12% der Jungs und
- ca. 22% der Mädchen
zwischen 48. und 60. Monat
- ca 90% aller Kinder
Zweite Züricher Studie
1974 - 1982
Blasenkontrolle tagsüber erfolgreich
mit 24 Monaten bei
- ca. 4% der Jungs und
- ca. 8% der Mädchen
mit 36 Monaten bei
- ca. 64% der Jungs und
- ca. 66% der Mädchen
zwischen 48. und 60. Monat
- ca 90% aller Kinder
Zusammenfassung
Der prozentuale Anteil der "trockenen" zweijährigen Kinder ist in der ersten Studie signifikant höher.
Die Analyse ergab, dass der Erfolg darauf basierte, dass die Kinder bis zu 10x pro Tag auf das Töpfchen gesetzt wurden.
Im Alter von 3 Jahren kehrt sich das Verhältnis der Prozentpunkte deutlich um.
Zwischen dem 36. und 48 Monat holen die Kinder der zweiten Studie wieder auf, sodass das Ergebnis nach vier Jahren lautete:
"Weder ein eindeutig positiver, noch eindeutig negativer Trainingseffekt ist nachzuweisen."
Erste Züricher Studie
1954 - 1956
Darmkontrolle erfolgreich
mit 12 Monaten bei
- ca. 22% der Jungs und
- ca. 38% der Mädchen
mit 18 Monaten bei
- ca. 51% der Jungs und
- ca. 68% der Mädchen
mit 24 Monaten
- ca. 77% der Jungs und
- ca, 87% der Mädchen
zwischen 48. und 60. Monat
- ca 98% aller Kinder
Zweite Züricher Studie
1974 - 1982
Darmkontrolle erfolgreich
mit 12 Monaten bei
- ca. 4% der Jungs und
- ca. 8% der Mädchen
mit 18 Monaten bei
- ca. 64% der Jungs und
- ca. 66% der Mädchen
mit 24 Monaten bei
- ca. 64% der Jungs und
- ca. 66% der Mädchen
mit 48 Monaten
- ca.95 % aller Kinder
mit 60 Monaten
- ca 98% aller Kinder
Zusammenfassung
Die Kinder der ersten Studie hatten die Stuhlausscheidung 18 bis 24 Monate früher unter Kontrolle, als die Kinder der zweiten Studie.
Die Analyse ergab dass es sich dabei nicht um eine Fähigkeit des Kindes handelte, sondern um einen Erfolg aufgrund intensiver elterlicher Überwachung des kindlichen Verhaltens, bzw. höherer Frequenz beim Töpfchentraining (bis zu 10x pro Tag).
Ein Überblick über die Entwicklung der Blasenkontrolle
Im Säuglingsalter
läuft die Blasenentleerung automatisch, unbewusst und ungehemmt ab Die Blase des Säugling entleert sich nahezu stündlich und 1-2 x pro Tag der Darm. Der auslösende Reiz zur Harnentleerung kommt von der volumenbedingten Dehnung der Blasenwand (s. ob.), welche zu einem Kontraktionsreflex des Detrusor vesicae und einer gleichzeitigen Relaxation der Sphinkter führt.
Ab dem sechsten Lebensmonat
reifen hemmende Bahnen heran. Die Kontraktionen der Blasenwand verringern sich, die Blasenkapazität steigt und die Miktionshäufigkeit nimmt ab. Die Hemmung ist weiterhin unwillkürlich, kann vom Kind nicht bewusst gesteuert werden.
Zwischen dem zweiten und achten Lebensmonat
erfolgen Blasen- und Darmentleerung meist nach den großen Mahlzeiten. Beginnt man in diesem Zeitraum mit einem Töpfchen- oder Toilettentraining, scheint dieses oftmals erfolgreich zu sein. Da die Reifung des ZNS zur Blasen- und Darmkontrolle sich erst zwischen dem 15-ten und 18-ten Lebensmonat auszubilden beginnt, ist eine willkürliche Kontrolle nicht gegeben. Der vermeintliche Erfolg basiert auf Konditionierung. Treten jedoch Änderungen im gewohnten Tagesablauf oder z.B. eine Phase des Zahnens ein, ändert sich meist auch die Regelmäßigkeit der Entleerung und der „Erfolg“ des Sauberkeitstrainings verschwindet wieder.
Zwischen dem achtzehnten und vierundzwanzigsten Lebensmonat
beginnt sich ein Gefühl für eine volle Blase und für Harndrang zu entwickeln. Jedoch ist die willkürliche Steuerung auch jetzt noch nicht immer zuverlässig, da eine noch unreife Blase hyperaktiv ist. Eine auftretende Dranginkontinenz und Pollakisurie ist in dieser Phase ganz normal.
Das Kind versucht instinktiv eine ungewollte Blasenentleerung zu verzögern bzw. zu vermeiden, indem es reaktive Tonuserhöhungen über z.B. Tippeln und Tänzeln auf den Fußballen inszeniert, oder per Druck ahnungslos den Bulbocavernosusreflex auslöst, über Beinekreuzen, durch Finger-Druck auf die Klitoris / die Penisspitze oder durch speziellen Fersendruck beim Sitz auf den Unterschenkeln.
Die Kontinenz bei Harndrang ist in dieser Phase also sehr stark vom externen Sphinkter und von der quergestreiften Beckenbodenmuskulatur abhängig.
Zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr
beginnt das körperliche System ein antidiuretisches Hormon (ADH) zu bilden. Es wird verstärkt nachts ausgeschüttet und bewirkt eine verringerte Harnproduktion, sodass die meisten Kinder im Alter von fünf Jahren nachts nicht mehr einnässen.
Um das vierte Lebensjahr
setzt die Willkürsteuerung ein. Die Hemmung der Blasenaktivität erfolgt nun kortikal, der gesamte Miktionszyklus wird vom ZNS kontrolliert.
Die Ausgereifte Blase
Speicherphase
Unter Sympathikus Aktivität kann sich die Blase druckfrei füllen. Der Musculus detrusor vesicae wird gehemmt, der Tonus im Musculus sphinkter urethrae internus und in der proximalen Urethra erhöht.

Miktionsphase
Durch eine passagere Inhibition des sympathischen Nervensystems bewirkt der Parasympathikus die Relaxierung des Trigonum vesicae und der urethralen Verschlussstrukturen. Die Hemmung des Detrusors wird aufgehoben. Die Entleerung erfolgt über die Kontraktion der Blasenwände.

Häufig gestellte Fragen:
Woran erkennt man, dass sich eine bewusste Kontrolle zu entwickeln beginnt?
Erste Anzeichen können sein, dass das Kind ...
- ... seine nasse Windel bemerkt und seine Umgebung darauf aufmerksam macht.
- ... die Signale für Harndrang wahrnimmt, wobei es z.B. kurz mit dem Spielen aufhört. Aber es kann die folgende Blasenentleerung noch nicht aufhalten. Meldet es dann „Ich hab' Pipi gemacht!" sollte es für diesen Meilenstein in der Entwicklung gelobt werden. Ihm wird bald bewusst, dass auf das Empfinden des Harndrangs die Entleerung folgt.
- ... Interesse am Töpfchen oder an den Toilettengängen der Familienmitglieder zeigt.
- ... Bescheid gibt, wenn es zur Toilette möchte, kann den Harndrang aber noch nicht ausreichend lange aufschieben, bis es das Töpfchen oder die Toilette erreicht. Als nächsten Schritt wird es den Harndrang zeitiger melden, um Hilfe beim Toilettengang zu bekommen.
Wieviel kann ein Kind in seiner Blase speichern?
Formel für die maximale Blasenkapazität eines Kindes in ml: (Alter x 30) + 30
Für ein einjähriges Kind bedeutet dies (1 x 30) + 30 -> 60 ml
Für ein dreijähriges Kind bedeutet dies (3 x 30) + 30 -> 120 ml:
Wie lange ist kindliches Einnässen normal?
Da die Blasenreifung von der ZNS-Reifung abhängig ist und zudem individuell sensibel reagiert, ist die Bandbreite dessen, was „normal“ ist, groß. Im Allgemeinen dauert der Reifungsprozess ca. vier bis fünf Jahre. Auf dem Weg zum Erreichen der perfekten Blasenkontrolle sind z.B. folgende Szenarien als Teil des Entwicklungsprozesses anzusehen.
- Nächtliche Einnäss-Ereignisse treten durchschnittlich bei nahezu jedem sechsten Kind (15 %) im Alter von 5 Jahren auf. Mit 10 Jahren erleben noch 5% der Kinder gelegentliches Einnässen. Jungs betrifft ein längerer Reifungsprozess mit Inkontinenzereignissen doppelt so oft als Mädchen. Als Ursache dafür gelten zum einen besonders tiefe Schlafphasen, zum anderen, dass der inhibierende ADH-Spiegel nachts noch nicht ausreichend hoch ist.
- Ist ein Kind in seinem Tun oder Spiel sehr vertieft, werden Signale für Harndrang ignoriert und die volle Blase entleert sich irgendwann unaufhaltsam. Dies nennt man „Spieleifernässen“ und kann bis ins Grundschulalter passieren.
WIE KANN ICH MEIN KIND AUF DEM WEG ZUR AUSSCHEIDUNGSAUTONOM BEGLEITEN?
- Sobald das Kind in seiner Entwicklung bereit dafür ist, wird es Neugierde für eine neu zu erlernende Fähigkeit zeigen. daher ist es wichtig abzuwarten, bis sich das Kind für Toilettengänge interessiert. Bevor das Kind nicht von selbst die Initiative ergreift, basieren alle von außen kommende Bemühungen zum Kontinenzerwerb auf Konditionierung und enge Überwachung seitens der Erziehenden.
- Kinder lernen u.a. durch Nachahmen. Ihr liebstes Vorbild sind Eltern und ältere Geschwister. Daher sollte ein Kind den Gang zur Toilette begleiten dürfen, wenn es darum bittet. So kann es seine Neugierde stillen, die verschiedenen Handlungsabläufe durch Zuschauen lernen und evtl.nachfragen.
- Vor der Kontrolle von Harn- und Stuhlausscheidung steht die Wahrnehmung dieser Vorgänge. Daher ist es ein großer Schritt in der Entwicklung, wenn das Kind meldet, dass "Pipi" oder "Kaka" in der Windel ist und verdient Lob. Es ist nun in der Lage die Blasen- / Darmentleerung wahrzunehmen und richtig zu benennen.
- Da eine unreife, hyperaktive Blase dem Kind zumeist nur wenig Zeit gibt die Toilette aufzusuchen, helfen Kleidungsstücke mit Gummizug am Bund, welche rasch heruntergezogen werden können. Auch zum selbständigen Wiederanziehen sind elastische Stoffe für das Kind einfacher zu händeln. Der Popo, der beim Hochziehen der Hosen oft im Weg steht, kann leichter überwunden werden.
- Ein Töpfchen sollte so bereitstehen, dass es vom Kind schnell erreicht werden kann.
- Möchte das Kind -wie die Großen- lieber die Toilette benutzen, so ist eine Sitzverkleinerung für die Klobrille eine wichtige Hilfe. Der Kinderpo ist noch zu schmal für die große Aussparung im Brillenring, und das Kind fürchtet ins Klo zu plumpsen. Eine Sitzverkleinerung gibt dem Kind Sicherheit und es kann entspannt auf der Toilette sitzen.
- Zum entspannten Sitzen ist es notwendig, dass die Beinchen nicht herunterbaumeln und versuchen müssen Halt zu finden. Ein kleiner Schemel hilft zum einen auf die Toilette hochzukommen und bietet zum anderen den Füßen eine Unterstützungsfläche beim Sitz auf dem Klo.
TIPP
Leitfaden KontinenzPflege
Ein Ratgeber für Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen, Großeltern ...