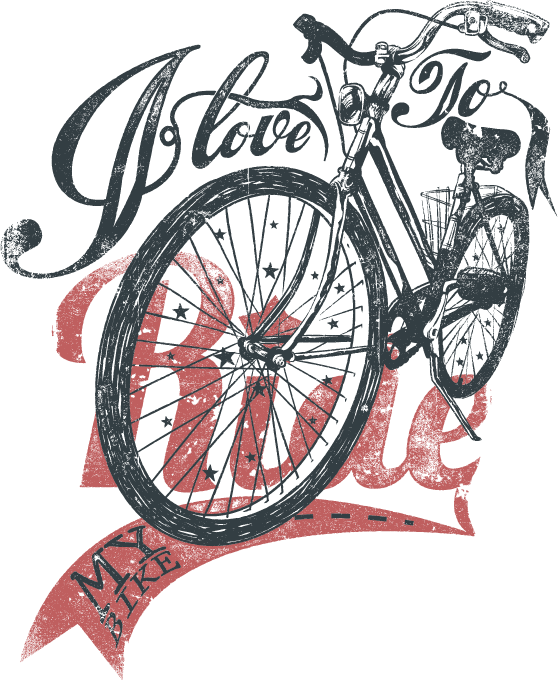Das Tanzberger-Konzept
DER VEREIN
Fragen RAT Tipp Geburt Übung Wissenscheck Film Alter CLIP
Harnblase
Blasenentzündung Erklärung
Kaiserschnitt
Kaiserschnittnarbe
Gurtfunktion ViDEO Prävention Lagerung Text Entleerungsstörung RückbilduNG Bauchmuskulatur rESTHARN Autotransfusion Lachen Bewegungsanalyse TONUSREGULATION download Übungsanleitung GEBURT BÜCKEN ADL Aufschubstrategie Schnüren durchblutung Soforthilfen Atmung leitlinieN Information Textbeitrag Hämorrhoiiden WISSENSFRAGEN ÖKONOMISCH TRAMPOLINFUNKTION Übungen KONTINENZPHYSIOTHERAPIE Schnürfunktion atemtherapie Heben Sectio Sectionarbe NARBENBEHANDLUNG
Anleitung
Bücken
Demomaterial
Tragen
Operation Kontinenz
Inkontinenz
Sphinktertraining
Sphinkter Verein
Kontinenzentwicklung
Kontinenzpflege
Ausscheidungsautonomie
SEXUALITÄT
Workshop
Befunde
BECKENBODENTHERAPIEBALL
FASZIEN
IMAGINATION.
EXPLOSIVLAUTE INSTRIKTION
Die multithematische, ganz andere Beckenboden-Sphinkter-Therapie
mit dem Tanzberger-Konzept
Die Integration sowohl physiologischer als auch psychologischer Trainingsfaktoren in das Kontinenztraining und die Kontinenz-Selbsthilfe bedingen maßgeblich deren Nachhaltigkeit.
Unsere Evaluation zeigt, dass bei ihrer therapeutisch gleichzeitigen Anwendung die urethrale und anale Kontinenzfähigkeit dauerhaft an Zuverlässigkeit gewinnt.

Die kooperativen, multithematischen Faktoren eines funktionsspezifischen Kontinenztrainings müssen sein:
- Mentales Training
- Systemisches Bewegungstraining
- Intrinsisches Training
mentales Training
Hier geht es um die muskuläre Re-Aktivierung mithilfe konkreter virtueller Struktur- und Bewegungsbilder.
Als ideomotorischer Effekt oder Carpenter-Effekt wird dasjenige Phänomen bezeichnet, welches durch das Vorstellen einer konkreten Bewegung bereits eine latente Innervation zur tendenziellen Bewegungslenkung auslöst.
Von Beginn an wurden in diesem Konzept - im systemischen Zusammenhang mit dem natürlichen Rhythmus der Atembewegungsphasen - die typischen Beckenboden- und Sphinkter-Bewegungen durch deren Imagination aktiviert und trainiert.
Das Ziel:
Mithilfe der „inneren Leinwand“ des Kopfkinos die Strukturen so zu aktivieren, dass ihr Erspüren erleichtert wird, um kontrollierbar auf die visualisierten Bewegungsabläufe übertragen werden zu können.
Diese drei Funktionen des Beckenboden-Sphinktersystems lassen sich primär nach dem ideomotorischen Prinzip triggern:
- Die anterior-posteriore Zugurtung der Mm. pubococcgeus et puborectalis, der sog. Beckenboden-Weichteilbrücke
- Die Manschetten-Schnürung des externen urethralen und analen Sphinkters
- Die schnellkräftige Trampolin-Bewegung als dehnungsreaktive levatorische Diaphragma pelvis-Funktion, verstärkt über den faszialen Katapulteffekt des Arcus tendineus musculi levatoris ani und des Lig. anococcygeale.
Erkenntnisse aus der Psychologie, Neurophysiologie und Sportwissenschaft besagen, dass das mentale Bild der strukturellen Orientierung dient, wobei diejenigen Muskelgruppen, die für die Realisierung der Bewegung zuständig sind, leicht innerviert werden.
So nutzen bekanntlich Sportler in ihren Trainingsprogrammen Bewegungsvorstellungen zur Leistungsoptimierung. Bewusst kodierte Inhalte stehen auf diese Weise für einen späteren Abruf zur Verfügung.
Beispiele vorher durchgespielter Handlungsabläufe sind:
- Der Aufschlag im Tennis
- der Abschlag beim Golf
- der Torlauf beim Ski-Slalom
Achtung!
Wichtig für Therapeuten und Übungsleiter: Ca. 2,5 % der Weltbevölkerung leiden an Afantasie. Die fehlende Vorstellungskraft wurde vor 10 Jahren von Psychologen und Ärzten unter dem neuen Begriff der „Afantasie“ eingeführt. Bei Abwesenheit jeglicher Vorstellungskraft entfällt diese spezielle therapeutische und sportliche Bewegungshilfe.
Systemisches Training
Hier geht es um rhythmisch-reaktivierendes, funktionsspezifisches Kontinenz-Training entlang der zuständigen myofaszialen Bewegungsketten.
Beispiel:
Die therapeutische Realisation aus diesem Konzept findet sich in allen Walz- und Aufprallübungen mit bzw. auf dem Beckenboden-Therapieball. Sie werden immer begleitet
- entweder von der widerständigen, stenosierten Ausatemführung auf dem vorderen CH
- oder von Kurzworten mit den endständigen, Spannung erhöhenden Konsonanten P oder T oder K.
Isolierte (An)Spannangebote im Sekundentakt aus einer mechanistisch orientierten Vergangenheit – zurückgehend auf den österreichisch-amerikanischen Arzt Arnold H. Kegel, 1894-1981 – sollten heutzutage therapeutisch als obsolet erkannt und endlich verworfen werden. Siehe Beitrag "Wille - Grundspannung - Realität"
Tipp:
Sei Dir der physiologischen Zusammenhänge bewusst und Deine Therapieangebote werden an geistiger Spannung für Dich selbst und gleichermaßen an der emotionalen Zustimmung Deiner Patienten gewinnen.
Denn:
In der Medizin, so auch in der präventiven und kurativen KontinenzPhysiotherapie, gibt es keinen besseren Wegweiser als die Physiologie des Menschen!
Intrinsisches Verhaltenstraining
Das „körperinnere“ Training ist unbedingtes Stellglied einer sich selbstregulierenden Strukturanpassung.
Wenigen ist bekannt, dass die Natur mit dem sog. intrinsischen Faktor ein „inneres Kontinenz-Training“ kreiert hat.
Wie sieht dieses intrinsische Kontinenz-Training aus?
Nach erfolgter Blasenentleerung bauen sich physiologisch, stimuliert durch den anwachsenden Volumendruck und den Zug der höhersteigenden Blase, adaptive Verschlusskräfte im Sphinkter auf.
Als Reizenergie sorgt der gesetzmäßig rhythmische Wechsel von Spannungsauf- und -abbau im Zyklus von Harnspeicherung und Entleerung fortlaufend für eine gesunde, Kontinenz sichernde Leistungsfähigkeit und damit für ein Training der Verschlussmuskulatur.
Dieser physiologisch sinnvolle, autonome Ablauf zur Kontinenzsicherung wird leider allzu oft - durch eine weit verbreitete Unwissenheit über die funktionellen Zusammenhänge von Harnspeicherung und Entleerung - verhindert.
Häufige, vorsorgliche Eingriffe in das natürliche Trink- und Entleerungsverhalten zur vermeintlichen Unterstützung der Kontinenzsicherung bzw. zur Verhinderung ungewollten Harnverlusts schwächen dagegen im Umkehrschluss langfristig die Kompetenz der sphinkteren Strukturen, entsprechend der bekannten Erfahrung:
Use it or lose it
Beachte:
Für die Aneignung der beschriebenen multithematischen Lernangebote benötigen Patienten eine fachkompetente Unterstützung!