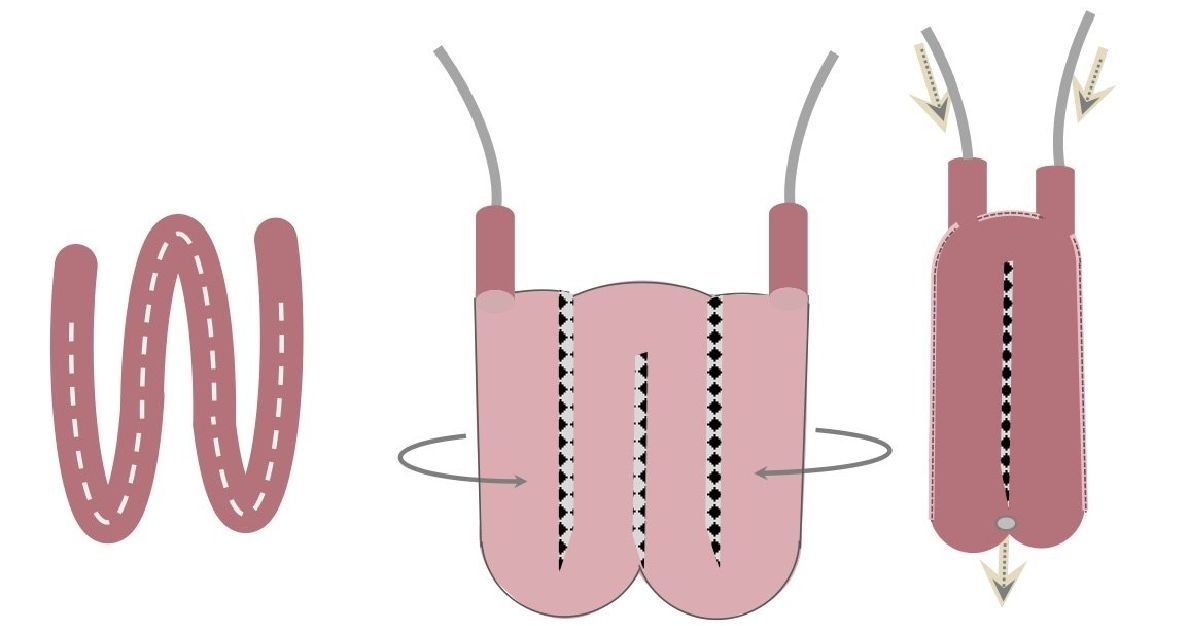Das Tanzberger-Konzept
DER VEREIN
Fragen RAT Tipp Geburt Übung Wissenscheck Film Alter CLIP
Harnblase
Blasenentzündung Erklärung
Kaiserschnitt
Kaiserschnittnarbe
Gurtfunktion ViDEO Prävention Lagerung Text Entleerungsstörung RückbilduNG Bauchmuskulatur rESTHARN Autotransfusion Lachen Bewegungsanalyse TONUSREGULATION download Übungsanleitung GEBURT BÜCKEN ADL Aufschubstrategie Schnüren durchblutung Soforthilfen Atmung leitlinieN Information Textbeitrag Hämorrhoiiden WISSENSFRAGEN ÖKONOMISCH TRAMPOLINFUNKTION Übungen KONTINENZPHYSIOTHERAPIE Schnürfunktion atemtherapie Heben Sectio Sectionarbe NARBENBEHANDLUNG
Anleitung
Bücken
Demomaterial
Tragen
Operation Kontinenz
Inkontinenz
Sphinktertraining
Sphinkter Verein
Kontinenzentwicklung
Kontinenzpflege
Ausscheidungsautonomie
SEXUALITÄT
Workshop
Befunde
BECKENBODENTHERAPIEBALL
FASZIEN
IMAGINATION.
EXPLOSIVLAUTE INSTRIKTION
NEOBLASE /
orthotope Darm-ersatzblase
PT: PRÄ- UND POST-OPERATIV

Abb.: © Das Tanzberger-Konzept e.V.
WAS IST EINE NEOBLASE?
Genau genommen wird keine neue Harnblase, sondern ein Ersatzspeicherorgan eingesetzt.
Es kann außer der Speicherung keine weiteren Funktionen des ursprünglichen Blasengewebes übernehmen.
Folgende Bezeichnungen treffen zu:
- orthotoper Blasenersatz,
- orthotope Darmersatzblase
- orthotope kontinente Harnableitung
WANN MUSS EINE HARNBLASE ERSETZT WERDEN?
Wenn die Funktion der Harnblase als Urinspeicher aufgehoben ist (siehe Hintergrundinformation 1).
Ursachen:
- Benigner oder maligner Harnblasentumor.
- Verletzungen nach Unfall oder durch Operation.
- Schrumpfblase, z.B. aufgrund chronischer Entzündungen oder Bestrahlungen
HINTERGRUNdinformatioN 1
ZYSTEKTOMIE
= Entfernung der Harnblase
- offene Zystektomie: über Bauchschnitt
- endoskopische Zystektomie: über Sonde
RADIKALE ZYSTEKTOMIE
Neben der Harnblase werden folgende, angrenzende Organe mitentfernt :
- beim Mann: Prostata und Samenblasen.
- bei der Frau: Uterus und deren Adnexe, Vorderwand der Vagina
Nach einer Zystektomie muss operativ ein neuer Weg für den Harnabfluss geschaffen werden.
WIE UND WORAUS WIRD
operativ EINE orthoToPe DarmErsatzblase
GEBILDET?
Abbildungen: © Das Tanzberger-Konzept e.V.
Ein 40-70 cm langes Stück des eigenen Dünndarms wird ausgeschaltet.
Mithilfe verschiedener Schnitttechniken wird aus dem Darmanteil eine Platte gebildet.
Diese wird in eine W- oder U- oder N-Form gebracht und an den Außenrändern so vernäht, dass ein kugelähnlicher Hohlkörper entsteht.
Kranial wird der Hohlkörper mit den beiden Harnleitern verbunden, kaudal mit der proximalen Harnröhre oberhalb des externen Schließmuskels.
Z I E L
ist die Herstellung eines Ersatzspeicherorgans mit einem Fassungsvermögen, das dem einer physiologischen Blase nahekommt.
WAS UNTERSCHEIDET DIE ORTHOTOPE DARMERSATZBLASE VON EINER PHYSIOLOGISCHEN HARNBLASE?
Die Wände bestehen aus Dünndarmgewebe. Folgende Funktionen einer natürlichen Harnblase fehlen:
unterschiede einer ORTHOTOPEN DARMERSATZBLASE ZU anderen Formen der operativ herbeigeführten Harnableitung
(Weitere Formen: siehe Hintergrundinformation 2)
Vorteile
- Die orthotope Ersatzblase kann den Urin wie eine Harnblase sammeln.
- Der Urin kann auf physiologischem Weg über die Urethra ausgeschieden werden.
Erreichbare Ziele
nach einer halbjährigen Rekonvaleszenz und Rehabilitation
- uneingeschränkte sportliche Aktivitäten, Schwimmbad- und Saunabesuche
- vollständige Kontinenz ohne Sicherheitsvorlagen
- selbständig Entleerung der Blase ohne Katheter
VORAUSSETZUNG
für die Schaffung einer orthotopen, kontinenten Harnableitung
- intakte Urethra
weitere Formen der künstlichen Harnableitung
- Sie werden in der Regel dann gewählt, wenn der Anschluss an die eigene Harnröhre nicht möglich ist.
- Ileum-Conduit oder Harnleiter-Hautfistel sind die häufigste Alternative zur orthotopen Darmersatzblase.
Pouch
= heterotope, kontinente Darmersatzblase
Pouch = engl. für Beutel,
hier: Kunstblase
Aus ca. 20 cm Ilieum wird ein Reservoir für den Urin geschaffen.
Seitlich werden die Ureter eingepflanzt.
Der aborale Anteil wird der Verbindungsgang nach außen und endet in einem Stoma im Unterbauch oder im Bauchnabel.
Aus Blinddarm oder Ileumanteil wird ein Ventilmechanismus gebildet. Über ihn kann der Urin per Katheter selbständig entleert werden.
Ileum-Conduit
= heterotope, inkontinente Harnableitung
Conduit = engl. für Verbindungsleitung
Eine aus kurzer Ileumschlinge gebildete Verbindung von den Uretern zum Stoma in der Bauchdecke und die Haut.
Am Stoma schließt ein Auffangbeutel für den Urin an.
Harnleiter-Darm-Implantation
= Enddarmblase
Eine aus Darmanteilen gebildete Tasche wird mit dem Enddarm verbunden
oder
Die Harnleiter werden direkt in den Enddarm implantiert.
Der Urin wird gemeinsam mit dem Stuhl ausgeschieden.
Voraussetzung für Kontinenz: intakter analer Sphinkter
HINWEIS: Erhöhtes Risiko zur Entwicklung von Darmkrebs .
Fistel
Harnleiter-Haut-Fistel
URETEROKUTANE OSTOMIE
= heterotope, inkontinente, einfache Harnableitung
Verbindung beider Ureter, um mit einer einzigen, direkten Verbindung den Urin nach außen in einen Auffangbeutel zu leiten.
Nierenfistel
Über einen speziellen Katheter wird der Urin direkt aus der Niere nach außen geleitet.
präoperative Physiotherapie
Bereits in den präoperativen Therapieeinheiten können neue, relevante Verhaltensweisen besprochen und eingeübt werden. Wie Untersuchungen zeigen, wirken sich Sicherheit und Zuversicht, die vor einer Operation erworben werden, positiv auf die Wundheilung aus.
Wahrnehmung schulen
Sensibilisieren für die subtilen Signale aus den Strukturen des kleinen Beckens
Ziel
- Kompensation der fehlenden Meldungen aus der Neoblase, z.B. über deren Füllzustand.
Bewusst machEN
Zusammenspiel von Diaphragma pulmonale und Beckenboden-Schließmuskel-System
Die Atemführung als Unterstützung eines eutonischen Beckenboden-Sphinkter-Training
- Einsatz der stenosierten Ausatmung als elastischer Widerstand zur Tonuserhöhung
- reaktiv vertieften Einatmung zum bewussten Loslassen der Sphinkterkontraktion
- Atemphasen als rhythmische Begleitung der Schnür- und Öffnungsbewegung
KENNENLERNEN
erster Übungen für
- den Sphinkter urethrae externus
- die quergestreifte Beckenbodenmuskulatur
EINÜBEN
strukturschonender Verhaltensweisen
- Ökonomischer Positionswechsel vom und zum Liegen
- Strukturschonende Darmentleerung
- Vermeiden von Pressatem bei körperlicher Anstrengung
- Ökonomisches Bücken, Heben, Tragen
- Funktionelle Soforthilfen: Hustendreh und Niesrück
Ziel
Vermeidung unphysiologischer Druckbelastungen im kleinen Becken
DIE ERSTEN SECHS MONATE POSTOPERATIV
- Übergangsphase -
GEWÖHNUNG AN HARNENTLEERUNGEN zu festen zeiten
Erklärung
Da das eingesetzte Darmgewebe keine Informationen über den Füllungszustand melden kann, ist es notwendig zu Beginn den Urin zu festgelegten Uhrzeiten zu entleeren. Ansonsten besteht die Gefahr einer Überdehnung des Ersatzgewebes mit
- nachfolgender Entleerungsstörung
oder
- unwillkürlichem Urinverlust im Sinne einer Überlaufinkontinenz
Betroffene entwickeln oft ein dumpfes Betroffenen entwickeln oft ein dumpfes Füllungsgefühl im Unterbauch und an den Flanken.
CAVE: Abgrenzung zu Beschwerden, die durch einen Rückstau in die Nieren ausgelöst werden.
Vorgehen
Die zeitlichen Abstände zwischen zwei Miktionen werden zunehmend verlängert:
- erster bis dritter Monaten postoperativ: alle 3 – 4 Stunden, auch nachts
- ab ca. viertem Monat postoperativ: tags und nachts alle 4 – 6 Stunden
- dauerhaft: nachts 1x zum Entleeren wecken lassen
Die Dehnfähigkeit des Darmgewebes nimmt mit dem zeitlichen Training zu. Die Ersatzblase sollte ein Füllvolumen von 250 bis 400 ml erreichen. Volumina von mehr als 450 ml sind zu vermeiden. (Begründung, siehe linke Spalte)
Besondere ENTLEERUNGSTECHNIKen
werden bereits während des stationären Krankenhausaufenthalts und einer eventuell anschließenden Reha eingeübt.
SITUATION
Die orthotope Ersatzblase kann sich nicht durch eigene Muskelkraft zusammenziehen.
und
Imperativer Entleerungsdrang kann nicht aus der Ersatzblase gemeldet werden, daher gibt es auch keinen Befehl an die Verschlussstrukturen zu öffnen.
Strategie
Erzeugen eines intraabdominellen Drucks, der den Urin aus der Ersatzblase drückt.
ZUGLEICH
Das Öffnen des urethralen Verschlusses muss bewusst herbeigeführt werden:
Vorgehen
Bauchmuskelkontraktion oder Druck mit der Hand auf den Unterbauch
ZUGLEICH
Entspannung der Beckenboden- und Sphinktermuskulatur
Hilfreich: Entleeren im Sitzen, entspannte Mundpartie
Der Entleerungsvorgang einer Ersatzblase dauert länger als der einer physiologischen Blase.
KONTINENZ-Wiedererlangen
Drei wesentliche Voraussetzungen für die Kontinenz stehen den Patient*innen in der ersten postoperativen Zeit noch nicht zur Verfügung:
adäquates füllvolumen
Die orthotope Ersatzblase hat anfangs noch ein ziemlich geringes Füllvolumen von ca.
100 bis 150 ml.
Korrekte
INTERPRETation
Informationen über der Füllungszustand der orthotopen Ersatzblase kommen von jetzt an aus dem umliegenden Gewebe (z.B.: Spannungs- oder Druckgefühl), denen bisher andere Interpretationen zugeschrieben wurden.
SPhinkter-
kompetenz
Der externe urethraler Sphinkter und die quergestreifte Beckenboden-Muskulatur müssen den Verschluss der Urethra ohne der Unterstützung des Sphinkter vesicae (interner urethraler Sphinkter) bewältigen. Ausdauer, Schnellkraft und adäquate intramuskuläre Koordination für diese Aufgabe fehlen noch, können aber trainiert werden.
PROGNOSE
FÜR DAS ERREICHEN
DER KONTINENZ
- Kontinuierliche Besserung innerhalb der ersten Wochen bis Monate.
- Nach den ersten sechs Monaten ist die Kontinenz i.d.R. tagsüber stabil.
- Eine nächtliche Inkontinenz kann jedoch dauerhaft bestehen bleiben.
Gelegentlich können spontane Inkontinenzereignisse auftreten
und eine
vorläufige Vorlagen-Versorgung notwendig machen.
HINTERGRUNDINFORMATION 3
dauerhaft nächtliche Inkontinenz
uRSAchEN
- physiologisch vermehrte, nächtliche Darmperistaltik
- fehlende Aufmerksamkeit im Schlaf für die Ersatzsignale, die über den Füllungszustand informieren.
ABHILFe
- feste Miktionszeiten nachts.
Erhöhter Flüssigkeitsbedarf
ERKLÄRUNG
Die Funktion des verwendeten Dünndarmabschnitts war und ist, Flüssigkeit an seinen Inhalt abzugeben.
DAHER
ist die tägliche Urinmenge in der Ersatzblase entsprechend erhöht.
DAHER
muss dieser zusätzliche Flüssigkeitsbedarf über Getränke und Nahrung aufgenommen werden, um eine Dehydrierung zu verhindern,
CAVE: ältere Personen mit vermindertem Durstgefühl
DAHER
wird Erwachsenen mit Darmersatzblase empfohlen täglich 2 – 3 Liter Flüssigkeit aufzunehmen. Alles, was Flüssigkeit enthält, wird miteinberechnet: Getränke, Suppen, wasserreiches Obst und Gemüse.
DAHER
darf die Trinkmenge abends NICHT reduziert werden, mit der Absicht den Urinverlust während der Nacht zu vermeiden. Gefährliche Flüssigkeitsverluste können die Folge sein.
POSTOPERATIVE PHYSIOTHERAPIE
ZIELE
MAßNAHMEN
Kompetenz und Wissen
- Struktur- und Funktionsbilder aufbauen
- Funktionellen Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der Kontinenz vermitteln
- Funktionelle Bezugssysteme der Beckenboden-Sphinkter-Einheit erfahren
Kontinente Verhaltensweisen im Arbeits-, Freizeit- und Bewegungsalltag
Struktur schonendes Alltagsverhalten erklären und einüben:
- Statik und Haltung (WS- und LBH-Mobilität bei Bedarf parallel therapeutisch behandeln)
- Positionswechsel
- Bücken, Heben, Tragen
- Defäkationsverhalten
- Sportliche Aktivitäten
- Kontinenzsichernde, funktionelle Soforthilfen (Hustendreh & Niesrück)
Spinkter-Kompetenz
Sphinktertraining
- selektiv
- kooperativ mit seinen Bezugssystemen
Normale Trophik
Eutonus
Schmerzreduktion
- Physikalische Begleitmaßnahmen
- Entspannungstechniken
- Spür- und Körperarbeit
- Atemarbeit
- Therapeutische Übungen
Wahrnehmungsfähigkeit
unter Einsatz von
- Gerichteter Aufmerksamkeit
- Atmung und Lauten
- Gesten, repräsentativ für die angestrebte Struktur und Funktion
- Physikalischer Begleitmaßnahmen
- FRZ, BGM etc.
Erwerb eines Ersatzgefühls für Blasenfüllung
- Sensibititätstraining
- Körperarbeit
- Atemarbeit
Systemische Kooperation Diaphragma pulmonale und Diaphragma pelvis
- stenosierte Ausatemtechnik auf dem vorderen CH (STF)
- Explosivlaute P oder T oder K am Wortende (FTF)
Reaktives, dynamisches, funktionelles und systemisches Fördern der 5 motorischen Fähigkeiten in der Sphinkter-Beckenboden-Einheit
- Ausdauer (STF)
- Kraft
- Schnelligkeit (FTF)
- Koordination (inter- und intramuskulär)
- Beweglichkeit
Therapeutische Übungen
- in verschiedenen ASTE
- ohne/mit Übungsmedien
- unter Atembegleitung
- mit/ohne begleitende Gesten
Kontinenz tagsüber
Bestmögliche Kontinenz nachts
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
Verhaltenstraining unter Verwendung des Trink-Miktions-Protokolls zur Verifizierung von:
- Ein- und Ausfuhrbilanz
- Management zur Restharnentleerung (Double Pee)
- Harndrangempfinden
- Trinkmengenverteilung
- Einhalten der zeitlich festgelegten Miktionen (v.a. nachts)
HINTERGRUNDINFORMATION 4
Besonderheiten einer orthotopen darmersatzblase
Zusatzbelastungen, mit denen die Patient*innen sich auseinandersetzen müssen
Harnstauung in die Nieren
Symptome:
Schmerzen in den Flanken
Ursache:
- Verengung an der Einpflanzungsstelle eines der Ureter in die Darmersatzblase
Ernsthafte Folge:
- Schädigung der Nieren
Restharn und Harnverhalt
Symptome:
Schwierigkeit einer vollständigen Entleerung bis hin zum Harnverhalt
Ursachen:
- narbige Verengung am Übergang von Darmersatzblase zu Harnröhre
- Blasensteine
- Wucherungen in Urethra
- vermehrte Schleimbildung
Mögliche Folgen:
- irreversible Gewebeüberdehnung der Ersatzblase
- Harnrückstau in die Nieren
- Schädigung der Nieren
- Blasensteinbildung
- Harnwegsinfekte
Schleimbildung
Symptome
- Urin ist trübe
- Urin enthält Schleimflöckchen
Ursache:
Darmschleimhaut behält die Fähigkeit zur Schleimproduktion bei.
Folgen gesteigerter Schleimproduktion:
- Abflussbehinderung
- Harnrückstau in die Nieren
- Schädigung der Nieren
- Blasensteinbildung
- Harnwegsinfekte
Veränderung im Säure-Basen-Haushalt
Symptome:
Abgeschlagenheit und Müdigkeit
Ursache:
Darmmukosa resorbiert Wasser und Elektrolyte, die von den Nieren ausgefiltert wurden.
Das Ausmaß der Rückreseorption ist abhängig von der Kontaktzeit des Urins mit der Darmmukosa und von der Elektrolytkonzentration im Urin.
In der Regel findest dies nur in geringem Maßes tatt und kann vom System ausgeglichen werden.
Cave bei Restharnbildung
-> höhere Konzentration im Urin und
-> längere Kontaktzeit mit Darmmukosa
Folgen:
- Übersäuerung
- Veränderung der Elektrolytkonzentration im Serum
Medikamenten-toxizität:
Ursache:
Medikamente, die vom Magen-Darm-Trakt absorbiert und unverändert über die Nieren ausgeschieden werden, können über das Darmgewebe wieder aufgenommen und dem Blutkreislauf zugeführt werden.
Folge:
Toxisch erhöhte Blutwerte
erhöhtes Risiko für Harnwegs-infekTE
Ursache
- Im Darm arbeitet das Epithel symbiotisch mit Darmbakterien
- Darmepithel hat -verglichen mit dem Urothel-eine geringere Fähigkeit eine bakterielle Besiedelung zu verhindern
Folge:
Erhöhte bakterielle Besiedlung im Urintrakt